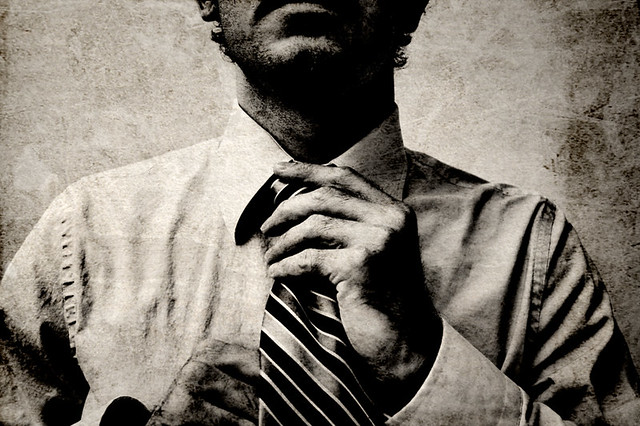Eine "Anleitung" zur Weisheit in 10 Punkten
Weise werden, das wollen wir alle irgendwie. Durch den eigenen Lebensweg die Ruhe finden, abgeklärt sein, nicht mehr mithetzen, sondern aus der Distanz beobachten und vielleicht kluge Ratschläge geben. Irgendwie ist es aber auch immer aufgeschoben: Alte Männer sind weise, altersweise. Alt und weise - das scheint nichts für uns mitten im Leben zu sein. Oder doch? Die
School of Life von Alain de Botton verfolgt eine ganz pragmatische Idee der Weisheit im Alltag, von der ich mich hier inspirieren lies. Auch wenn wir nie vollkommen weise werden können, kann uns das Konzept der Weisheit als ein Fluchtpunkt im Leben den Weg zu einem bewussteren und glücklicheren Leben weisen. Was also ist Weisheit, wodurch zeichnen sich weise Menschen aus?
1. Realismus
Weise Menschen sind zuallererst realistisch. Sie wissen, wie anstrengend viele Dinge im Leben sind. Das heißt nicht, dass sie nicht optimistisch wären, aber ihnen ist die Komplexität der vielen Herausforderungen im Leben bewusst: Kinder großziehen, ein eigenes Business starten, ein schönes Wochenende verbringen, die Welt verbessern, sich verlieben... Zu wissen, dass sie etwas schwieriges angehen, nimmt dem Weisen nicht die Ambitionen, es animiert ihn vielmehr zum durchhalten, macht ihn geduldiger und mindert die Panik, wenn die Dinge auf dem Weg zum Ziel unweigerlich schief gehen.
2. Dankbarkeit
Da ihnen klar ist, wie viel im Leben schief gehen kann und wird, sind weise Menschen gegenüber Momenten der Ruhe und Schönheit besonders aufmerksam, auch wenn diese Momente nur sehr unscheinbar oder kurz sein mögen und von anderen in ihrer Eile gar nicht bemerkt werden. Der Weise versteht es, selbst einen
ereignislosen sonnigen Tag oder ein paar Mauerblümchen, den Anblick eines dreijährigen selbstvergessen spielenden Kindes oder den Abend mit Freunden voll und umfänglich zu genießen. Nicht etwa, weil sie sentimental und naiv sind, sondern im Gegenteil: Sie wissen genau, wie schwer die Dinge sein können und ziehen deshalb die größte Befriedigung aus dem Schönen, egal wann und wo es sich zeigt. Das ist Dankbarkeit gewachsen aus
Offenheit gegenüber dem Moment, wie er sich präsentiert.
3. Wahnwitz
Der weise Mensch weiß, dass er wie alle Menschen tief in den Wahnwitz des Lebens verstrickt ist: Unser Verlangen ist oft irrational und verträgt sich nicht mit unseren eigentlichen Zielen. Vieles an uns selbst ist uns nicht bewusst, wir sind launisch, unterliegen verrückten Fantasien oder Täuschungen über uns selbst. Wir sind unseren Körpern und unserer Sexualität ausgeliefert. Der Weise ist nicht überrascht, dass wir lebenslang unreif bleiben, dass unsere Perversionen uns für immer begleiten, egal für wie klug und moralisch wir uns halten. Da weisen Menschen klar ist, dass mindestens die Hälfte des Lebens mit unserer Ratio nicht zu fassen und zu bewältigen ist, sind sie auf den lauernden Wahnsinn vorbereitet und bleiben gefasst, wenn er sich zeigt.
Der Weise lacht über sich selbst. Er hält sich mit Urteilen zurück und ist skeptisch gegenüber seinen eigenen Erkenntnissen. Wenn er sich dann mal einer Sache gewiss ist, dann ist diese Gewissheit weniger zerbrechlich und angreifbar. Weise Menschen amüsieren sich über den Widerspruch zwischen unserem noblen Anspruch an die Dinge und der verkorksten Art und Weise, in der sich am Ende alles manifestiert.
4. Höflichkeit
Weise Menschen sind sich über die große Bedeutung sozialer Beziehungen im Klaren. Im Zweifel bedeuten diese Beziehungen mehr als immer Recht zu behalten oder unbedingt die Wahrheit zu sagen. Sie wissen, wie schwer es ist, die Meinung eines anderen zu ändern oder gar sein Leben zu beeinflussen. Sie sind daher sehr zurückhaltend und sagen anderen nicht um jeden Preis, was sie von ihnen halten. Ihnen ist klar, dass es selten etwas bringt, andere zu kritisieren. Wichtiger scheint ihnen, dass soziale Beziehungen funktionieren, selbst wenn das heißt, nicht brutal ehrlich zueinander zu sein. Beispielsweise können sie mit jemandem aus dem entgegengesetzten politischen Lager zusamen sitzen, ohne den anderen umerziehen zu wollen. Sie halten sich zurück, wenn sie meinen, jemand erziehe seine Kinder falsch. Sie wissen, dass die Dinge aus der Perspektive eines anderen Menschen ganz anders scheinen. Weise Menschen suchen eher nach dem, was die Menschen verbindet, als nach dem, was sie trennt.
5. Akzeptanz
Wer weise ist, hat seinen Frieden mit sich selbst gemacht und akzeptiert, dass es einen großen Unterschied zwischen dem eigenen Idealbild und dem realen Ich gibt. Sie vergeben sich ihre Idiotie, ihre Fehler, Hässlichkeiten, ihre Beschränktheit und die Rückschläge. Sie schämen sich nicht für sich selbst und müssen deshalb nicht lügen oder heucheln. Ohne Eitelkeit können sie sich und ihre Fehler und Neurosen ziemlich genau beschreiben. Ihnen fällt es leicht, anderen zu erklären, warum sie manchmal nur schwer zu ertragen sind (weshalb sie oft die erträglicheren Gefährten sind).
6. Vergebung
Weise Menschen sind auch realistisch in ihren Erwartungen gegenüber Mitmenschen. Sie verstehen den
großen Druck, den viele verspüren, um ihren eigenen Ambitionen gerecht zu werden, um ihre Interessen zu verteidigen oder ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wir können dadurch extrem gemein und bösartig wirken. Aber meist ist es gar nicht so persönlich gegen andere gerichtet. Wer weise ist, versteht, dass wir uns die meisten gegenseitigen Verletzungen nicht absichtlich zufügen. Es sind eher Kollateralschäden der blind konkurrierenden Egos in einer Welt der begrenzten Ressourcen.
Daher geraten weise Menschen nicht besonders schnell in Wut und sie lassen sich nur selten zu Urteilen hinreißen. Sie ziehen keine voreiligen Schlüsse darüber, was in anderen vorgeht. Weil ihnen klar ist, wie schwer jedes Leben voll von Ambitionen, Enttäuschungen und Verlangen ist, sind sie zu schneller Vergebung bereit. Sie verstehen den Druck, unter dem wir alle leiden. Wer weise ist, fühlt sich nicht von der Aggression der anderen verfolgt, weil er verstehrt, wo diese Aggression herkommt: Aus einer verletzten Seele.
7. Widerstandskraft
Weise Menschen wissen, wozu sie fähig sind. Sie verstehen, dass so vieles schief gehen kann und dass man trotzdem weiterlebt. Viele Menschen meinen, dass ihr Glück an so vielen Umständen hängen würde: Geld, Beziehungen, Ruhm, Gesundheit und so weiter. Auch der weise Mensch schätzt diese Dinge, aber er macht sich und sein Glück nicht davon abhängig, weil er weiß, dass diese Dinge vergänglich sind. Er kann sein Glück auch ohne sie schätzen.
8. Neid
Wer weise ist, versteht, dass es gute Gründe dafür gibt, dass wir nicht all das haben, was wir haben wollen. Sie kennen die Konsequenzen des Gewinnens und Erfolgs. Auch sie gewinnen gern, aber sie wissen, dass die grundlegenden Dinge im Leben davon unberührt bleiben. Sie überschätzen die Folgen des Erfolgs nicht und wissen, dass wir vielmehr von unseren eigenen Persönlichkeiten abhängen, als von unseren Jobs oder den materiellen Gütern, die wir erwerben. Erfolg und Niederlage liegen viel dichter zusammen, als es unsere moderne Welt wahrhaben möchte.
Weise Menschen sehen den erfolgreichen Manager, den Medienstar oder den Millionär und sie wissen, warum sie es nicht dahin geschafft haben. Vielleicht haben sie nicht so hart gearbeitet, haben nicht deren Ehrgeiz, vielleicht nicht mal ihre Intelligenz?
Andere
Schicksale sind vielleicht lediglich auf Zufälle zurückzuführen. Manch einer wird ohne guten Grund befördert, mancher gewinnt im Lotto oder hatte die richtigen Eltern. Gewinner sind nicht immer gut und nobel. Wer weise ist, versteht die Fügungen von Glück und Zufall und wird sich dafür nicht selbst verantwortlich machen.
9. Reue
In unserer Zeit der großen Ambitionen beginnen viele mit dem Traum, ein makelloses und erfolgreiches Leben zu führen und die richtigen Entscheidungen von Karriere bis Liebe zu treffen. Weise Menschen wissen, dass ein makelloses Leben unmöglich ist und dass jeder riesige und oft unkorrigierbare Fehler in verschiedenen Lebenslagen machen wird.
Perfektionismus ist eine wahnsinnige Illusion und Reue ist unvermeidbar.
Die Reue wird aber erträglich, wenn wir verstehen, dass Fehler ein Teil jeden Lebens sind. Egal in wessen Leben man hineinschaut, man wird immer verheerende Fehlentscheidungen und Niederlagen finden. Das ist keineswegs zufällig, sondern vielmehr strukturell notwendig: Fehler treten auf, weil niemand von uns all die Information hat, um immer die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen. Oft lenken wir da unser Leben völlig blind, wo es am meisten drauf ankommt.
10. Ruhe
Weise Menschen wissen, dass Unruhe und Tumult überall lauern und ausbrechen. Diesen Ausbruch sehen sie kommen und sie fürchten ihn. Deswegen pflegen sie solch eine
Hingabe zur Ruhe und Stille. Ein ruhiger Abend ist für sie eine Errungenschaft und ein Tag ohne Besorgnis muss gefeiert werden. Ein bisschen Langeweile schreckt sie nicht, es könnte - und es wird irgendwann wieder - alles viel schlimmer sein.
Und - Sind Sie weise?
Wahrscheinlich wird niemand sagen, dass er weise ist und all die Punkte oben auf ihn zutreffen. Das wäre in sich schon ziemlich töricht. Aber vielleicht haben wir nach dieser Lektüre den einen oder anderen Punkt bemerkt, an dem wir zu verkrampft sind, wo wir uns etwas lockern und der Weisheit einen Schritt näher kommen können. Was meinen Sie: Helfen diese Punkte auf dem Weg durchs Leben? Lassen Sie es uns unten in den Kommentaren wissen.
Das sollte Sie auch interessieren: