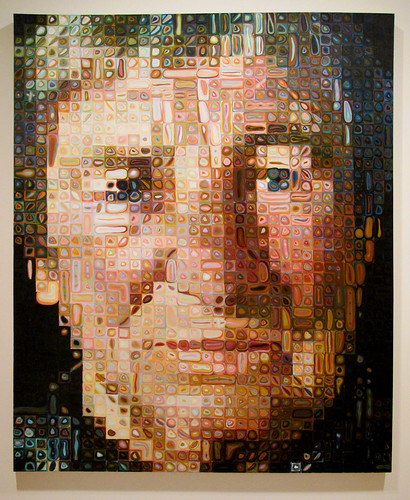Alleinsein, Freundsein und die Qualität von Gefühlen
Die
Introversion ist eines meiner Lieblingsthemen. Nicht nur, weil ich darin einen Kern meiner Persönlichkeit gefunden habe, der viele andere Persönlichkeitsaspekte beeinflusst. Introversion interessiert mich auch deshalb, weil es eine existenzielle Grundsituation eines jeden Menschen zuspitzt und greifbar macht: Alleinsein. Introvertierte haben eine besondere lebensphilosophische Gabe im Umgang mit dem Alleinsein. Sie spüren sogar einen inneren Zwang zum Alleinsein. Das ist schon spannend. Ein anderer Aspekt, der selten beleuchtet wird, ist das Recht auf Privatheit, das Recht auf ein Geheimnis, das Recht, auch mal unverstanden zu bleiben. Dieses Recht ist für unsere Identität entscheidend und Introvertierte gestehen sich selbst und anderen dieses Recht meistens ganz intuitiv zu. Sie drängen sich nicht auf, nehmen sich eher zurück, behalten Dinge gern für sich. Alleinsein ist für sie auch eine Frage des Respekts: Jeder Mensch hat das Recht, auch mal für sich zu sein.
Wir sind immer allein
Wir alle - egal ob intro- oder extrovertiert - kommen nicht umhin, uns mit dem Alleinsein auseinanderzusetzen. Im ganz banalen Sinne schon ganz früh in der Kindheit und später, wenn wir uns beim Alleinsein erst ängstigen und dann langweilen. Aber auf eine Art sind wir immer allein, auch und gerade wenn wir unter Freunden sind: Jedes Missverständnis, jede etwas andere Interpretation einer gemeinsam erlebten Situation, selbst verschiedene Vorlieben zeigen uns, dass wir in einem existenzialistischen Sinne allein sind. Wir können uns zwar verständigen, werden aber nie dieselben Bewusstseinsinhalte haben, die etwa unser bester Freund hat. Wir können uns gegenseitig nicht verstehen, sondern nur interpretieren. Wer das nicht begreift, kann es schwer haben im Leben, denn Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten lassen uns dann verzweifeln, wir nehmen sie persönlich oder denken, dass andere einfach blöd sind.
Sind Introvertierte bessere Freunde?
Wie ich schon sagte, haben Introvertierte eine besondere Gabe, wenn es ums Alleinsein geht. Sie sind gern allein und finden in sich selbst häufig ein ganz reiches emotionales Leben, das nicht darauf angewiesen ist, dass es mit anderen geteilt wird. Diese Gabe allein reicht noch nicht, man muss sie auch "anwenden" können. Dazu zählt auch eine gewisse Balance, sich selbst verstehen und sich selbst auch mal aus dem Versteck wagen, um dann wieder das Alleinsein bewusst genießen zu können. Dazu gehört sicher auch, andere in sein Leben zu lassen, Freunde zum Beispiel und vor dem Hintergrund der eigenen Introversion den anderen ihre Identität zu lassen. Introvertierten wird auch immer wieder bescheinigt, dass sie sehr loyal sind und die ganz wenigen Freunde, die sie in ihr Leben lassen, eng an sich binden können. Eine treue Leserin meines Blogs schrieb mir dazu neulich folgende Zeilen:
Dadurch, dass man nur zu wenigen Leuten Zuneigung empfindet, ist diese dafür aber stärker ausgeprägt und ganz besonders wenn die Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht. Dadurch erwartet man vielleicht eine Art "Exklusivität" die andere nicht unbedingt zurück geben können, erst recht nicht, wenn es sich bei ihnen um Extrovertierte handelt.
Diese Beobachtungen werfen interessante psychologische und auch philosophische Fragen auf. Erst einmal kann es natürlich so aussehen, dass die Zuneigung, die Introvertierte empfinden, stärker ausgeprägt ist. Vielleicht, weil wir ganz allein mit dieser einen Person viel Zeit verbringen und sie deswegen die einzige Empfängerin unserer Zuneigung ist. Aber ist die Zuneigung deswegen stärker? Und stärker, als was eigentlich? Wir werden es kaum beurteilen können, ob andere (meinetwegen Extrovertierte) eine weniger starke Zuneigung empfinden. Wie könnten wir das im Alltag testen?
Die Qualität von Gefühlen
Ich glaube, wir können die Stärke unserer Gefühle nicht ohne Weiteres mit der anderer Menschen vergleichen. Wir haben ja keinen Zugang zum Empfinden der anderen und können unser Urteil nur auf unsere Beobachtungen als Indiz für ihre Gefühle stützen. Als Beispiel: Nur weil jemand stärker unter seinen Zahnschmerzen stöhnt, als ein anderer, können wir daraus noch nicht schließen, dass er auch wirklich stärkere Schmerzen hat. Es ist ein Indiz, aber kein Beweis.
Man könnte auch sagen, dass für einen Vergleich von Gefühlen oder Schmerzen ein objektiver Referenzpunkt fehlt. Man kann Schmerzen und andere Gefühle nicht wie ein Erdbeben auf einer Richterskala messen. Ohne diesen objektiven Referenzpunkt ist dann das Reden von mehr oder weniger Schmerzen oder Gefühlem nicht sehr sinnvoll. Zuneigung und Gefühle sind dann eben jeweils individuelle Qualitäten und nicht Quantitäten.
Die Exklusivität unserer Zuneigung, die wir als Introvertierte vielleicht nur einem Freund schenken, lässt es so erscheinen, als würden wir viel stärker für ihn empfinden, als jemand, der seine Zuneigung auf fünf Freunde, statt auf einen "verteilt". Zuneigung ist aber nicht unbedingt wie ein Liter Wasser, der eine einzelne Person ganz durchnässt, während er verteilt auf fünf Personen diese nur etwas bespritzt. Zuneigung ist eine Qualität unseres Bewusstsein, ein Gefühl und das muss nicht geringer ausfallen, nur weil man es auf mehrere "Projektionsflächen" (sprich: Freunde) verteilt.
Diese Erkenntnis kann uns auch dann helfen, wenn wir die Exklusivität, die wir anderen geben, nicht gespiegelt bekommen. Nur, weil ein guter Freund noch vier weitere gute Freunde hat, heißt das nicht, dass er weniger Zuneigung für mich empfindet, als ich ihn für ihn.
Den anderen nicht verstehen ist OK
Vielleicht steckt hinter der Enttäuschung über die mangelnde Exklusivität einfach ein Missverständnis. Nämlich das, dass der andere doch genauso sein muss wie ich. Ich kann nur für einen ganz viel empfinden. Dann muss doch die Zuneigung zu vielen geheuchelt sein.
Hier sind wir wieder am Ausgangspunkt dieses Artikels: Wir sind fundamental allein in unserem Bewusstsein. Um dieses Alleinsein überbrücken zu können, müssen wir es erst einmal verstehen. Nur dann, wenn wir dem anderen Menschen neben uns und uns selbst zugestehen, dass wir ihn in seinem Anderssein nicht vollends begreifen können, können wir die Toleranz und das Verständnis für die Welt dieses anderen aufbringen. Auf das volle Verständnis des anderen verzichten zu können, heißt auch, ihm oder ihr einige Geheimnisse zu lassen, die Person nicht voll zu durchdringen und das Recht auf Identität und Privatheit zuzugestehen. Gerade den introvertierten unter uns wird das gefallen. Wir müssen sagen können: Ich verstehe dich nicht ganz, aber genug, um dein Freund zu sein. Dann können wir auch ertragen, wenn dieser Freund seine Zuneigung anders zum Ausdruck bringt und auf mehr Leute verteilt, als wir selbst es tun würden.